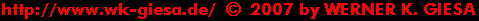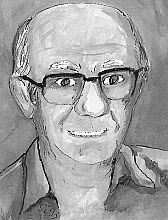 Kurt Giesa
Kurt Giesa
* 10.7.1913 19.1.2001
Angefangen hat es schon einige Jahre vorher, nur haben wir uns dabei nie etwas gedacht und die Zeichen an der Wand nicht gesehen. Vielleicht hätte man damals dem allmählichen Niedergang noch entgegenwirken können. Vielleicht aber auch nicht ich weiß es nicht.
Richtig akut wurde es dann im Oktober 1998 und fortan von Monat zu Monat schlimmer. Aber fangen wir lieber ganz vorn an ...
Geboren als Bauernsohn im ostpreußischen Szabienen, Kreis Angerburg, »flüchtete« mein Vater so bald wie möglich aus der ungeliebten Landwirtschaft. Er wurde Polizist und als Aufseher im Straflager Papenburg eingesetzt, wo die Nazis mißliebige »Elemente« zwangsarbeiten ließen die sogenannten »Moorsoldaten«. Über diese Bezeichnung konnte sich mein Vater immer kräftig aufregen, weil er durch die Indoktrinierung des Hitler-Regimes überzeugt war, daß es sich samt und sonders um echte Kriminelle und nicht vorwiegend um politische Sträflinge handelte.
Als der größenwahnsinnige Diktator den 2. Weltkrieg entfesselte, wurde mein Vater zwangsläufig Soldat. Anfangs bei der Kavallerie (ja, damals gab's tatsächlich noch berittene Soldaten! Später allerdings wurde auf Fahrräder umgestellt; die waren pflegeleichter, und die Pferde konnte man zu Proviant verarbeiten), machte er den Frankreich-Feldzug mit, wurde später Kommandeursfahrer auf der griechischen Insel Rhodos und schwärmte später immer davon, somit damals einen Cadillac fahren zu können (vermutlich ein beschlagnahmtes Fahrzeug). Er geriet in englische Gefangenschaft, die er in Ägypten ertragen mußte. Als er endlich nach Deutschland zurückkehrte, stand ihm der Weg zurück in die Justiz nicht mehr offen, er mußte sich als einfacher, ungelernter Arbeiter durchschlagen. Sägewerk, Straßenbau, wo er es zum Vorarbeiter brachte, Hochbau, Arbeit in einer Möbelfabrik, schließlich doch endlich wieder im öffentlichen Dienst als Lagerverwalter in einer Bundeswehrkaserne bis zur Rente.
1949 heiratete er meine Mutter, fünf Jahre später wurde ich geboren. 1964-65 erfolgte der Hausbau im westfälischen Lippstadt, bei dem mein Vater fast mehr an Eigenleistung erbrachte, als die Baufirma zusammenstoppelte. Das Haus, an dem er stetig weiterbastelte, war wohl die größte Herausforderung an seine handwerklichen Fähigkeiten. Ich habe ihn immer bewundert für das, was er zustande brachte, was er mit einfachsten Mitteln schuf, auf genial-einfache, aber wirkungsvolle Weise. Er steckte voller praktischer Ideen, die er auch stets umzusetzen wußte. Dazu bewirtschaftete er den riesigen Garten, und Zeit für die Familie blieb auch immer noch an jedem Wochenende waren wir mit dem Auto unterwegs. Und wohin auch immer es ging Väterchen besaß ein sagenhaftes Orientierungsvermögen. Eine Strecke, die er ein einziges Mal vor 20 Jahren gefahren war, kannte er später immer noch bis auf die letzte Bordsteinkante genau!
Irgendwann vor fünf oder sechs Jahren ließ das nach, auf bekannten Strecken fuhr er an Abzweigungen vorbei, die er eigentlich hätte benutzen müssen, und suchte dann, mit der ihm eigenen Ungeduld, die ich wie auch sein cholerisches Temperament leider geerbt habe, nach dem richtigen Weg. Auch bei der Gartenarbeit zeigten sich erste Schwächen; er wollte irgend etwas erledigen, ging hinaus, überlegte, was er eigentlich tun wollte, kehrte wieder um, dann fiel es ihm doch noch ein und er erledigte es ...
Normale Alterserscheinungen, dachten wir alle, auch er selbst. Immerhin hatte er die 80 bereits überschritten. Und es war ja auch alles gar nicht so schlimm; was er tun wollte, schaffte er noch immer, und sein Herzschrittmacher verhalf ihm zu relativer Fitneß. Daß er nur noch mühsam sehen konnte, was sich links von ihm und zu seinen Füßen abspielte, schien nicht weiter tragisch, damit konnte er recht gut leben, indem er den Kopf entsprechend stärker drehte oder neigte Folge eines Schlaganfalls, den er locker überstanden hatte.
Heute weiß ich, daß man damals vielleicht medikamentös etwas hätte tun können. Zumindest hätte es den geistigen Abbau zwar nicht verhindert, aber verzögert. Aber schlau ist man immer erst hinterher.
In jenen Jahren war ich auch relativ selten in Lippstadt; 1985 waren meine Frau und ich ins hessische Altenstadt in der Nähe von Frankfurt gezogen, fast 300 Kilometer entfernt. Auch wenn ich meine Wohnung im Elternhaus nie aufgegeben habe, zog mich nicht viel nach Lippstadt, weil es eine stete Rivalität zwischen meinem Vater und mir gab; zudem mochte er meine Frau nicht und drohte ständig damit, mich zu enterben. Eine leere Drohung; ich habe nie nach dem Erbe geschielt, weil ich durchaus fähig war und bin, meine Existenz aus eigener Kraft zu gestalten und mich nie in ein gemachtes Nest setzen wollte. Vielleicht wurde er auch nicht recht damit fertig, daß ich »kein richtiger Arbeiter« war, der morgens zur Firma hoppelt, den ganzen Tag über schuftet und abends heimkehrt zur Bierflasche und zum Fernseher. Ich verdiente mein Geld am Schreibtisch, verdiente damit sogar weit mehr, als er sich jemals erträumen konnte (damals waren die Honorare weit besser als heute), und ich arbeitete nachts und »verschlief« deshalb den halben Tag. Nach außen hin gab er zwar kräftig mit seinem schriftstellernden Sohn an, aber innerlich war er nicht mit dem einverstanden, was ich tat. Er hatte sich wohl einen Sohn gewünscht, der in seine Fußstapfen trat, der handwerklich geschickt war ... und ich bin nun mal der Theoretiker mit zwei linken Händen, während er der Praktiker war. So konnten wir niemals richtig zusammen kommen. Wir haben zwar hin und wieder gemeinsam am Haus herumgebaut, aber ich konnte nur ungern mit meinem Vater zusammenarbeiten. Da hatte wiederum ich meine Minderwertigkeitskomplexe gegenüber seinem handwerklichen Geschick.
Dann, während der Buchmesse 1998, kam Mütterchens besorgter Anruf: Mit meinem Vater sei etwas nicht in Ordnung, er sei plötzlich nachts ständig im Haus unterwegs, schalte überall das das Licht an und nicht wieder aus ... und ein paar eigenartige Dinge mehr.
Wir fuhren nach Lippstadt. Väterchen war tatsächlich seltsam verändert. Meine Mutter, selbst schon immer kränklich und mittlerweile auch sehr gebrechlich schon über ein Jahr vorher zur gelegentlichen Rollstuhlfahrerin geworden , war mit der Situation überfordert.
Der Hausarzt diagnostizierte »beginnende Demenz« und wies meinen Vater zur näheren Untersuchung ins Krankenhaus ein. Väterchen begriff das überhaupt nicht; warum sollte er ins Krankenhaus, er war doch völlig gesund! Meine Mutter begleitete uns, als ich ihn einlieferte, und bis zum letzten Moment war er fest überzeugt, daß sie in Behandlung sollte, aber doch nicht er!
Er hatte unbemerkt einen zweiten, diesmal »kleinen« Schlaganfall erlitten, der zwar keine körperliche Auswirkungen zeigte, aber seine Gedächtnisstörungen forcierte. Er konnte die Uhr nicht mehr richtig lesen, die Tageszeit nicht mehr genau definieren, hell und dunkel nicht mehr immer voneinander unterscheiden. Im Sommer, nachmittags um 15 Uhr, ließ er die Rolläden herunter, weil es doch Abend und dunkel war! Bei strahlender Helligkeit schaltete er das Licht ein, weil er überzeugt war, daß wir alle doch in der Dämmerung nicht mehr richtig sehen konnten, und nachts stand er auf und war überzeugt, es sei heller Tag.
Was speziell meine Mutter nervte, weil er sie dadurch natürlich in ihrem Schlaf störte; später pflegte er sie dann auch folgerichtig regelmäßig zu wecken, wenn er der Ansicht war, es sei Tag. Dies geschah immer häufiger, zum Schluß im Stunden- oder Halbstunden-Rhythmus!
Sein Kurzzeit-Gedächtnis war praktisch nicht mehr existent. Was er tat, wußte er Augenblicke später schon nicht mehr. Eines Nachts, bei einem meiner üblichen »Kontrollgänge«, war er gerade aus dem Schlafzimmer gekommen, stand am Korridorlichtschalter und schaltete in permanenter Folge ein und aus und ein und aus und ... »Warum machst du das?« fragte ich. »Was denn?« kam es zurück. »Das ständige Ein- und Ausschalten.« Während er fleißig weiter schaltete, sagte er erstaunt: »Aber das [klick] tue ich [klack-klick] doch [klack] gar nicht!« Als ich ihm klarzumachen versuchte, daß das andauernde, schnelle Schalten der Glühbirne gar nicht gut tue, ging er nicht darauf ein, sondern murmelte etwas von »Es ist so dunkel hier, im ganzen Haus brennt überhaupt kein Licht« und tappte durch den hell erleuchteten Korridor zum Wohnzimmer, wo er das Schalterspiel sofort zu wiederholen begann. Aber nur für ein paar Sekunden dann platzte eine der Birnen der Wohnzimmerlampe, ein Feuerstrahl und die Glassplitter flogen nur um wenige Zentimeter an seinem Gesicht vorbei, und anschließend war's tatsächlich im ganzen Haus dunkel, weil die Hauptsicherung 'rausgeflogen war. Ich schaltete sie wieder ein, stellte erleichtert fest, daß Väterchen unverletzt war, sammelte die Scherben ein, und währenddessen schlurfte er zur Küche, um ... ja, was wohl? Von jenem Lichtschalter konnte ich ihn dann auch wegbugsieren, im nächsten Moment entdeckte er das Kontrollämpchen eines halb unter dem Küchentisch stehenden Heizradiators und deutete darauf: »Da ist doch auch noch ein Lichtschalter! Ich komme da nicht 'ran, kannst du da nicht mal draufdrücken ...?«
Nacheinander entwickelte er noch mehr seltsame Hobbies. Zum Beispiel das Schmalerschneiden von Bank- und Kreditkarten, weil die dann angeblich besser in die Hüllen paßten, oder das Abschneiden überstehender Kanten an nur noch halbvollen Margarinebechern. Was er in die Finger bekam, mußte hinterher stets in langwierigen Aktionen gesucht werden, weil er es nie wieder dorthin legte, woher er es nahm. Eine Zeitlang war er der Ansicht, sich den ganzen Tag über noch nicht rasiert zu haben, schnappte sich den Apparat, rasierte Haut, in der bald schon keine Barthaarwurzel mehr leben konnte, und kaum hatte er den Rasierapparat wieder aus der Hand gelegt, kam er zu dem Schluß, sich heute noch gar nicht rasiert zu haben ...
Als der Nachbar sein Haus um eine halbe Etage aufstockte, zerbrach beim Betonanrühren eine der Schaufeln, und der Nachbar fragte, ob wir ihm nicht so ein Werkzeug ausleihen könnten. In Gegenwart meines Vaters reichte ich ihm eine unserer Schaufeln über den Zaun. Später behauptete mein Vater steif und fest, meine Mutter hätte dem Nachbarn diese Schaufel gegen seinen, Vaters, erklärten Willen ausgehändigt, und forderte diese Schaufel vehement zurück. Wofür er sie denn nun so dringend selbst brauche, wollte Mütterchen von ihm wissen. Ja nun, er wollte eben den Kompost umschichten. »Das will ich sehen«, drängte sie, und er fing tatsächlich an und verlor nach ein paar Schaufelstichen die Lust an der Sache. Als meine Frau und ich das nächste Mal nach Lippstadt kamen, gab es plötzlich zwei Schaufeln, beim übernächsten Mal drei, dann vier ... Irgendwie muß er wahrhaftig in unbeobachteten Momenten bei den diversen Nachbarn auf Beutezug gegangen sein. Dabei hatte es immer den Anschein, als traue er sich nicht mehr vom Grundstück, nachdem er sich einige Male unweit des Hauses verirrt hatte und vom Nachbarn eingefangen und heimgebracht wurde.
Lange ließ er es sich nicht nehmen, Müll und Abfall 'rauszubringen, sortierte aber grundsätzlich falsch in die Trennbehälter ein. Als ich plakative »Gebrauchsanweisungen« an Hausmüll-, Bio- und Altpapiertonne anbrachte, fuhr er mich zornig an, was mir den einfiele, er wisse doch auch so, was wohinein gehöre, und warf es prompt wieder gezielt falsch ein.
Bei solchen Gelegenheiten geduldig zu bleiben, ist nicht immer einfach, schon gar nicht bei meinem cholerischen Temperament.
Schlimm war es, wenn er einen seiner wenigen lichten Momente hatte und mitbekam, wie es um ihn stand. Nie zuvor habe ich meinen Vater weinen gesehen; jetzt schon. Er betete ständig: »Lieber Vater im Himmel, sei mir gnädig, hol mich zu dir.« Er, der früher einmal einen Geistlichen vom Grundstück jagte, mit den »Schwarzkitteln« nichts zu schaffen haben wollte und erst im hohen Alter doch noch religiös wurde ...
Aber am schlimmsten war es jedesmal, wenn er wegen irgendwelcher Erkrankungen vorübergehend ins Krankenhaus mußte. Krankenhausärzte haben die bedauerliche und bösartige Eigenart, so grundsätzlich wie unnötig mit Medikamenten zu experimentieren und sich den Teufel um die Medikamentierung durch den Hausarzt zu scheren und jedesmal, wenn wir Väterchen wieder heim holten, war er durch andere Medikamente und andere Dosierungen dermaßen durcheinander und aus dem Takt gebracht, daß wir oft mehr als vier Wochen benötigten, ihn wieder einigermaßen »einzustellen«. Er wurde jedesmal übermäßig mit der chemischen Keule malträtiert, wie der Hausarzt es einmal treffend formulierte; vermutlich, um ihn ruhigzustellen und seinen geistigen Zustand dabei immer wieder total zu verpfuschen. Ich frage mich in immer noch vorhandener Wut, weshalb Krankenhäuser überhaupt Diagnosen und Medikamentierungsangaben von den Hausärzten anfordern, wenn sich die Vollbluttrottel von Krankenhausärzten sowieso nicht daran halten und dummdreist die hausärztlichen Verordnungen ihren eigenen nötig werdenden Therapien anpassen, statt, wie es die Vernunft gebietet, es genau umgekehrt zu tun. Traue keinem Arzt weiter, als du ihn werfen kannst!
Mit zunehmender Verwirrung wurde mein Vater auch zunehmend aggressiver. Er bedrohte meine Mutter, möglicherweise auch, weil sie mit seinem Verhalten nicht zurechtkam und ihn reizte und provozierte, und eines Nachts hörte ich in der unteren Wohnung recht eigenartige Geräusche, kam hinzu und konnte ihn gerade noch daran hindern, meine Mutter zu erwürgen. Daraufhin installierten wir eine Bildüberwachungsanlage, um eine bessere Kontrolle zu haben.
Aber die beste Kontrolle nützt nichts, wenn niemand da ist ... und wir konnten schließlich nicht ständig in Lippstadt präsent sein. Zuhause gab's ja auch immer wieder einiges zu tun, und auch wenn ich mir in Lippstadt ein Zweitbüro für meine Arbeit eingerichtet hatte: Ein Zweitarchiv und eine Zweitbibliothek anzulegen war unmöglich. Also pendelten wir ständig hin her. Eine Woche Altenstadt, eine Woche Lippstadt, eine Woche Altenstadt, zwei Wochen Lippstadt, dann drei Wochen Lippstadt, und so weiter. Zwar kam zweimal täglich der Pflegedienst, um die Grundpflege und andere »Kleinigkeiten« durchzuführen, aber damit war natürlich noch nichts gewonnen.
Als nächstes gewöhnte Väterchen sich an, nachts das Haus zu verlassen natürlich im Schlafanzug, auch in klirrender Winterkälte. Um zu verhindern, daß er sich auf diese Weise schwer erkältete, schlossen wir abends alle nach draußen führenden Türen ab; die Schlüssel behielten nur wir und meine Mutter. Was also tat Väterchen? Er bediente sich seiner umfangreichen Werkzeugsammlung, die Inhaber so mancher Profiwerkstatt vor Neid hätte erbleichen lassen, und begann, die Türschlösser zu zerstören. Ich sammelte alles Werkzeug ein und nahm es unter Verschluß, um weitere Aktionen dieser Art zu verhindern.
Einmal marschierte er dann am hellen Tag nur in der Unterhose nach draußen vors Haus und kam wenig später völlig niedergeschlagen zurück; Kinder hatten ihn ausgelacht. Allmählich begann die Situation, unhaltbar zu werden. Der Pflegedienst drängte auf eine Heimunterbringung. Aber damit taten wir uns alle schwer; meine Eltern hatten beide nie in ein Heim gewollt, und ich mochte es meinem Vater auch nicht antun. Obgleich er sich im eigenen Haus immer weniger zurechtfand und immer wieder erklärt bekommen mußte, wo denn Toilette und Schlafzimmer waren. Irgendwie muß er erinnerungsmäßig dann auch in seiner ostpreußischen Kindheit gelandet sein; er begann die Toilette außerhalb der Wohnung und schließlich außerhalb des Hauses zu suchen.
Während unserer Abwesenheit gelangte er dabei eines Nachts, obwohl niemand mehr damit gerechnet hatte, daß der immer gebrechlicher werdende Mann die Treppe noch schaffen würde, in die obere Wohnung, stürzte dort und lag stundenlang in einem der Zimmer, bis er morgens vom Pflegedienst nach einer Suchaktion völlig unterkühlt gefunden und ins Krankenhaus gebracht wurde. Als ich ihn dort besuchte, war er im Krankenbett fixiert wurden er schlug um sich, wollte aus dem Bett flüchten, und sich den Katheter und den Tropfschlauch abreißen. Es kam, was kommen mußte; eine amtsgerichtliche Begutachtung ergab, daß er unter »Betreuung« gestellt werden mußte, wie es heute im »politisch-korrekten« Neudeutsch heißt; früher nannte man es unmißverständlich Entmündigung und Vormundschaft. Ich übernahm die »Betreuung«, die ich keinem Außenstehenden überlassen wollte. Nach dem Krankenhausaufenthalt kam er auf ärztliches Anraten zunächst für drei Wochen in Kurzzeitpflege; so bekamen wir meine Mutter, meine Frau und ich wenigstens für diese Zeit eine kleine Ruhepause.
Mittlerweile war er auch inkontinent geworden. Aber daran, Pampers zu tragen, wollte er sich nicht gewöhnen und war stets redlich bemüht, sich die Dinger schnellstens wieder vom Leib zu reißen. Es war ein von Tag zu Tag größer werdendes Drama, ihn davon abzuhalten.
Ich begann nach einem Platz im Pflegeheim zu suchen. Im Lippstädter Raum war nichts zu machen; alles belegt und überfüllt. Durch die Hilfe unserer Wohnungsnachbarn in Altenstadt kam ich dann an die Adresse eines Seniorenpflegeheims im benachbarten Ortenberg. Und wir hatten gleich doppeltes Glück: erstens war sofort ein Platz verfügbar, und zudem finanziell weit günstiger als in Lippstadt, obgleich ich eigentlich mit dem Gegenteil gerechnet hatte; Lippstadt ist hintersibirische Provinz, und die Lebenshaltungskosten im Frankfurter Umfeld wesentlich höher.
Ich fuhr Väterchen nach Ortenberg, und ich werde eine Szene wohl nie vergessen, die mich fast für die zwei Jahre immer größer werdender zeitlicher und psychischer Anspannung entschädigte: Mein Vater saß im Büro, und die Sozialarbeiterin fuhr seinen Zimmergefährten per Rollstuhl herein, um die beiden miteinander bekannt zu machen. Beide starrten stur aneinander vorbei. »Na, zuerst mal sagt man doch Guten Tag«, appellierte die Sozialarbeiterin. Keiner der beiden Gentlemen zeigte sich an solch grüßendem Tun interessiert. »Herr Schmidt«, fuhr die Frau fort, »das ist der Herr Giesa, Ihr neuer Zimmernachbar.« Reaktion: Null. »Herr Giesa, das ist der Herr Schmidt.« Worauf mein Vater sich zum Herrn Schmidt drehte, ihn so streng wie stirnrunzelnd musterte und dann in inbrünstiger Überzeugung verkündete: »Den kenne ich nicht!«
Womit er ja nun zweifelsfrei Recht hatte ... nur ich armer Teufel konnte mir das Lachen nicht verkneifen und schaffte es gerade noch, zum Bürofenster zu flüchten und die Landschaft draußen anzulachen. Die wirkliche Komik der Situation kann vermutlich nur ermessen, wer dabei war ...
Es war der 16. November 2000. Zwei lange Jahre waren überstanden. Und es ist sicher gut, daß mein Vater, der nie in ein Altenheim wollte, bis zum Schluß nicht begriffen hat, wo er sich nun befand. Er wähnte sich in einer Bahnhofshalle oder einem Bahnhofshotel vielleicht glaubte er, die Reise, die mit der zweieinhalbstündigen schnellen 300-km-Fahrt von Lippstadt nach Ortenberg begonnen hatte und während der er sich die Umgebung stumm, aber sehr aufmerksam angeschaut hatte, ginge bald weiter. Jedenfalls tappte er jeden Morgen aus seinem Zimmer ins Büro, wollte eine Fahrkarte kaufen und setzte sich dann in den großen Gemeinschaftssaal, in Schuhen, Mütze und Lederjacke, um auf den Zug zu warten. Ich besuchte ihn zwei- bis dreimal pro Woche, und einmal nahm ich ihn mit zur Tür: »Siehst du da draußen Schienen?« »Nein.« »Dann kann doch auch kein Zug kommen.« »Sicher, aber gleich kommt ein Bus, der mich zum Zug bringt.« Er hatte für alles immer eine Erklärung, die in seine Fantasiewelt paßte, in der sich immer tiefer verwurzelte. Zwischendurch fragte er auch immer wieder nach meiner Mutter, die er zuhause schon häufig nicht mehr erkannt hatte, und wollte wissen, wie es ihr ging, ob sie denn wieder gesund sei, und wann sie dann nachkäme.
Anfang Januar zog er sich eine Erkältung zu, von der er sich aber wieder recht gut erholte. Als ich ihn zum letzten Mal sah, war er wieder so gut wie genesen.
Drei Tage später, in der Nacht vom 19. zum 20. Januar 2001, hat er sich still, sanft und für uns alle überraschend aus dem Leben davongeschlichen. Als ich ihn dann am frühen Morgen sah, lag er so friedlich und entspannt da, wie ich ihn niemals zuvor gesehen habe und wie ich es auch bei keinem anderen Toten zuvor sah. Geradeso, als habe ihm der Gott, an den er glaubte und zu dem er ständig betete, er möge ihn doch endlich zu sich holen, die Hand gereicht und ihm eine wunderbare neue Welt gezeigt.
Werner K. Giesa, November 2001
|
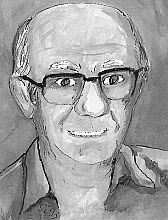 Kurt Giesa
Kurt Giesa
 Else Giesa, geb. Löffler
Else Giesa, geb. Löffler